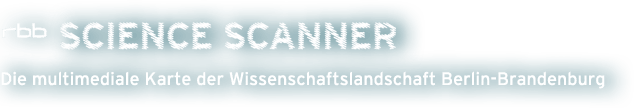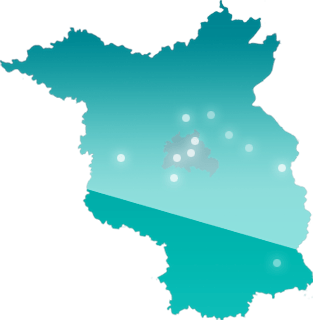Interview mit dem Präsidenten der Freien Universität Berlin - 10 Fragen an Prof. Dr. Peter-André Alt
Die Wissenschaftslandschaft Berlin-Brandenburg birgt ein riesiges Potenzial, sagt Prof. Dr. Peter-André Alt, Präsident der Freien Universität Berlin. Doch auf diesem "großen wissenschaftlichen Heiratsmarkt" müsse es auch zu Eheschließungen kommen, die lange halten, so Alt. Im Interview erklärt der Literaturwissenschaftler, warum sich trotz teilweise harter Bedingungen seiner Meinung nach eine Karriere in der Wissenschaft immer noch lohnt.
1. Mit welchen großen Zukunftsfragen beschäftigen sich Forscherinnen und Forscher an der FU Berlin?
Eine große Zukunftsfrage ist die Biodiversität: Wir befinden uns in einer komplexen Lebensumwelt, die sowohl unter biologischen als auch klimatischen und sozialen Risikoeinflüssen steht. Diese Einflüsse muss man untersuchen, um herauszufinden, wie die Risiken minimiert werden können. Der Forschungsverbund Berlin-Brandenburg Institute of Advanced Biodiversity Research (BBIB) hat die Biologie im Fokus, mit einem Schwerpunkt im Bereich der Pflanzenforschung. Auch die Bereiche Biochemie, Medizin und die Sozialwissenschaften, zum Beispiel die Umweltforschung, werden mit einbezogen. Das BBIB, in dem die Freie Universität mit drei Universitäten und fünf Leibniz-Instituten der Region kooperiert, behandelt sicher eines der wichtigsten Themen des 21. Jahrhunderts.
2. Was sind für die FU Berlin die größten Herausforderungen für das Jahr 2014?
Zum einen müssen wir den Normalbetrieb, die Lehre und Forschung, am Laufen halten: Wir haben uns dazu verpflichtet, eine hohe Zahl von Studentinnen und Studenten an die Universität zu holen und sie in einer angemessenen Zeit zum Abschluss zu bringen. Die zweite ständige Herausforderung ist die Einwerbung von Drittmitteln. Diese machen mittlerweile rund 30 Prozent unseres Etats aus. Ein weiterer Vorsatz für 2014 ist, die Zusammenarbeit mit der außeruniversitären Forschung zu intensivieren. Außerdem wollen wir noch mehr junge Start-ups fördern und im Bereich Technologietransfer unsere Aktivität weiter steigern. Auch der Baubereich ist seit Jahren eine Herausforderung. Wir haben vor über zehn Jahren die Campussanierung in Gang gesetzt und nun große Teile dieser Arbeit abgeschlossen. Aber es gibt in den naturwissenschaftlichen Instituten noch dringende Sanierungsprozesse, die wir bewältigen müssen - etwa im Fachbereich Chemie.
3. Was macht Ihrer Meinung nach die Qualität der Wissenschaftslandschaft Berlin-Brandenburg aus und wo sehen Sie Probleme?
Ein riesiges Potenzial ist zunächst einmal die Vielfalt aus forschungs-und leistungsstarken Universitäten und sehr profilierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Nur München ist, was die Dichte dieser Einrichtungen angeht, mit der Region Berlin-Brandenburg vergleichbar. Das Profil unserer Wissenschaftslandschaft hat in den letzten Jahren dadurch gewonnen, dass wir uns noch besser vernetzen und intensiver zusammenarbeiten. Diese Stärke ist aber zugleich auch ein Problem, denn die Wissenschaftseinrichtungen können sich ihre Partner aussuchen. Das ist einerseits von Vorteil, weil es eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten der Fächer, Themen und Methoden gibt. Der Nachteil besteht darin, dass sich manche Einrichtungen die Partnersuche offen halten möchten. Es ist wie ein großer wissenschaftlicher Heiratsmarkt, auf dem das Angebot überaus reich und reizvoll ist, aber es muss dann auch zu Eheschließungen kommen, die nachhaltig sind und möglichst lange halten.
4. Die Förderung sehr vieler wissenschaftlicher Projekte ist zeitlich befristet. Für wie sinnvoll erachten Sie das?
Auf der einen Seite brauchen die großen Forschungsthemen natürlich eine gewisse Zeit, ehe sie entwickelt und weitergedacht werden. Aber sie haben auch eine Verfallszeit. Die Themen großer Forschungsverbünde, beispielsweise in den Bereichen Klima oder Ernährung, verlangen irgendwann neue Ausrichtungen. Mit anderen Worten: Wenn sich ein Cluster oder ein Sonderforschungsbereich bildet, dann ist es sinnvoll, den über zehn oder zwölf Jahre zu fördern, aber es ist danach auch geboten, Themen zu wechseln. Das Problem von kurzzeitiger Förderung ist, dass wir mit dieser keine Infrastruktur aufbauen und nur schwer Personal gewinnen können. Insofern muss man eine gute Balance finden zwischen einer längerfristigen Planung und kurzfristiger Förderung.
5. Die Hochschulfinanzierung muss neu geordnet werden. Wie würden Sie sich eine solche Neuordnung wünschen?
Die allgemeine Klage darüber, dass wir zu wenig Geld haben führt uns nicht weiter. Wir müssen uns zunächst einmal fragen: Was möchte man eigentlich erreichen? Einige Maßnahmen in den letzten Jahren waren durchaus nutzbringend für Bildung und Forschung: der Hochschulpakt, die Exzellenzinitiative, der Qualitätspakt Lehre. Aber wir brauchen in der Tat eine neue Art der Hochschulfinanzierung und ich hoffe, dass die große Koalition in der Lage ist, diese Notwendigkeit zu erkennen und umzusetzen. Wir brauchen eine stärkere Bundesfinanzierung für die strategische Planung der Universitäten. Außerdem muss ein Anreizsystem geschaffen werden, das die Zusammenarbeit mit der außeruniversitären Forschung intensiviert und die Hochschulen in die Situation bringt, diese Partnerschaften aktiv zu gestalten. Wir müssen den Artikel 91b im Grundgesetz über die Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern bei Bildung und Forschung gar nicht ändern, im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten kann durchaus schon einiges verbessert werden.
6. Stichwort Plagiate: Funktioniert Ihrer Meinung nach die Selbstkontrolle in der Wissenschaft?
Es gibt in jedem System immer wieder Fälle, in denen nicht korrekt nach den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis gearbeitet wird - ob das jetzt Datenfälschungen oder Plagiate sind. Das muss geahndet werden, wir müssen aber auch realistisch bleiben, man wird es nicht komplett ausschließen können. Beim Thema Promotion wurde in der Vergangenheit ein Fehler gemacht: Man ist davon ausgegangen, dass die Steigerung der Promotionsquoten automatisch ein sinnvolles Ziel ist. Es darf nicht sein, dass Wissenschaftler bis zu 40 oder mehr Doktoranden betreuen, es muss eine realistisch handhabbare Anzahl von Promovenden sein, die entsprechend auch mentoriert und unterstützt werden können. Hier ist die Wissenschaft in der Pflicht, bei der Betreuung, aber auch bei der Zulassung zur Promotion, Qualitätssicherung zu leisten.
7. Befristete Verträge, unsichere Perspektiven: Warum sollten junge Akademikerinnen und Akademiker trotzdem eine Karriere in der Wissenschaft und nicht in der Industrie anstreben?
Wir haben sehr viele Bewerbungen auf Mitarbeiterstellen, Promotionsstipendien und Juniorprofessuren. Offensichtlich ist der Arbeitsplatz Hochschule und ist das System Wissenschaft so attraktiv, dass viele in dieses System drängen. Das ist aber natürlich zu kurz gegriffen. Wer eine wissenschaftliche Karriere anstrebt, braucht Durchhaltevermögen und muss bereit sein, gerade in der Qualifizierungsphase viel zu arbeiten. Man muss auch bereit sein, nur kurzfristige Perspektiven zu haben. Was wir dem Nachwuchs aber bieten müssen, sind mindestens dreijährige Stellen und die Möglichkeit, nach der Promotion mittelfristig zu planen. Wissenschaft lohnt sich noch immer. Es ist ein Arbeitsfeld in dem Eigenständigkeit gefordert ist, viel Spielraum für Kreativität vorhanden ist und viele Möglichkeiten bestehen, sich permanent intellektuell weiterzuentwickeln.
Lange Arbeitszeiten, insbesondere für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Qualifizierungsphase: Das klingt nicht sehr familienfreundlich.
Es klingt erst einmal nicht familienfreundlich - gerade wenn beide Partner in der Wissenschaft arbeiten. Aber wir tun an der Freien Universität sehr viel dafür, dass die Rahmenbedingungen für diejenigen, die Familienverantwortung tragen, stimmen. Beispielsweise unsere Kindertagesstätte ist von sieben Uhr dreißig bis zum Abend zugänglich, die Kleinen werden hier qualifiziert betreut. So können Eltern sicher sein, dass ihre Kinder hier gut untergebracht sind, während sie arbeiten – auch wenn sie einmal Termine am Abend oder am Wochenende haben. Ein Vorteil in der Wissenschaft ist wiederum, dass in bestimmten Grenzen die Arbeitszeit recht flexibel gestalten werden kann.
8. Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit - ist das auch Ihr Konzept zur beruflichen Gleichstellung von Mann und Frau?
Nein, ich hüte mich davor Frauenförderung mit Familienfreundlichkeit gleichzusetzen. Gleichstellung spielt auch jenseits dieses Themas eine wichtige Rolle für uns. Wir betreiben seit den späten 70er Jahren Frauenforschung an der Freien Universität und haben mit der Zeit ein System entwickelt, Frauen besser zu fördern. Mittlerweile sind 30 Prozent aller Professuren von Frauen besetzt. Das ist noch nicht ausreichend, aber besser als an allen anderen deutschen Universitäten. Bei den Juniorprofessuren haben wir 50 Prozent Frauen, bei den Promotionen ebenso. Für die Frauenförderung erhalten die Fachbereiche spezifische Mittel und wir haben ein Förderprogramm für W2-Professorinnen auf Zeit etabliert. Wir wissen außerdem, dass Frauen - eher als Männer – es schwerer haben mit der erfolgreichen Profilierung und Selbstdarstellung bei Bewerbungen. Da müssen wir ansetzen. Wir haben ein Mentorinnen-Programm, in dem Alumni der Freien Universität Doktorandinnen fördern. Für Postdocs haben wir eine ähnliche Fördermaßnahme und wir werden auch für Juniorprofessorinnen in Zukunft ein Mentoringprogramm etablieren. Berlin hat außerdem das ProFiL-Programm, das allen Universitäten zur Verfügung steht, in dem besonders qualifizierte Wissenschaftlerinnen auf Bewerbungsprozesse vorbereitet werden.
9. Wer im Ringen um Drittmittel die Nase vorne haben will, muss auch die Öffentlichkeit auf seine Seite ziehen. Welche Kommunikationsstrategie verfolgen Sie?
Als Wissenschaftseinrichtung werden wir durch die Öffentlichkeit finanziert. Wir haben daher den Anspruch, dass unsere wissenschaftliche Arbeit auch für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sorgen dafür, dass Forschungsergebnisse unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu aktuellen Themen, wie beispielsweise Klimaveränderungen oder Steuerpolitik, verständlich dargestellt kommuniziert werden.
Die FU hat mehr als 10.000 Facebook-Freunde und auch einen eigenen Twitter-Kanal. Welche Rolle spielen soziale Medien für die FU Berlin?
Eine moderne Einrichtung muss präsent sein, auch in Social-Media-Kanälen. Erstens geht es um schnelle Kommunikation. Bei einer Sturmwarnung vor einiger Zeit beispielsweise kam die Frage auf, ob der Lehrbetrieb schließen muss. Da haben wir unsere Entscheidung über die sozialen Medien kommuniziert und das hat sich sehr schnell dann auch rumgesprochen. Aber es geht auch um Meinungsbilder und Resonanz. Wir bekommen viele Anregungen, zum Beispiel: "Warum ist diese Veranstaltung nicht breit genug kommuniziert worden?" oder "Was denkt sich die Universität, wenn sie Betriebsferien im Winter macht um Heizkosten zu sparen?". Das dient auch der Klarstellung und deshalb freuen wir uns, dass wir so viele Follower haben.
10. Welche Frage würden Sie gerne mal beantworten, die Ihnen aber nie gestellt wird?
"Was wollen Sie mit Ihrer Wissenschaft wirklich zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben beitragen?" Also die Grundfrage: Ist Wissenschaft wirklich eine Zukunftsgarantie? In allen Sonntagsreden wird gesagt: Wir brauchen Bildung, wir brauchen Wissenschaft. Aber ich würde mich damit noch einmal differenzierter auseinander setzen, warum das wirklich so ist. Eine ganz wichtige Dimension von Wissenschaft ist, dass sie ein Denken in Alternativen aufzeigt. Eine Welt, in der eine friedliche Koexistenz der Interessen herrschen soll um sozialen Ausgleich und Gerechtigkeit zu schaffen, kann von der Wissenschaft lernen, dass es keine absoluten Wahrheiten, sondern vielfach Zwischentöne, Nuancen und Ambivalenzen gibt.